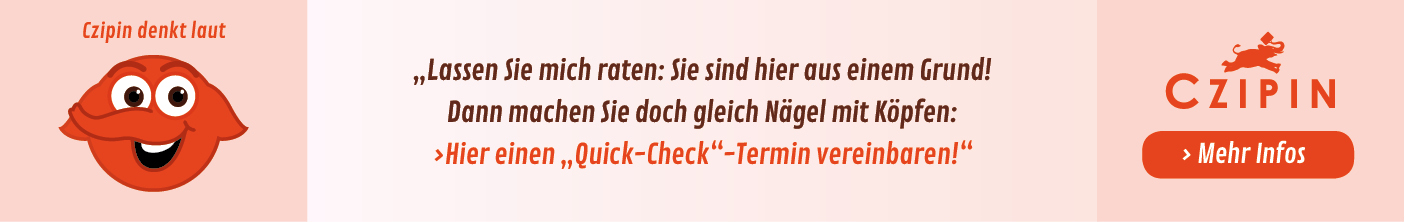Eine denkwürdige Nacht vor 15 Jahren in der Ukraine hat mir einmal mehr gezeigt, dass Fachwissen allein oft nicht das Wichtigste ist.
REISE NACH NIKOPOL. Im Mai 2008 bin ich gerade in der Wiener City unterwegs, als mein Telefon läutet. Es ist meine Assistentin: „Hallo Alois, da ist jemand aus der Ukraine, der dringend mit dir sprechen will.“ Ich nehme das Gespräch an, und es meldet sich in sehr schlechtem Englisch der Technikvorstand eines Rohrproduzenten in Nikopol. Weder der Ort noch das Unternehmen sagen mir etwas, aber genau das weckt meine Neugier. Es stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrieb mit 2.000 Mitarbeitern handelt, der seine Wettbewerbsfähigkeit dringend verbessern muss.
Eine denkwürdige Nacht vor 15 Jahren in der Ukraine hat mir einmal mehr gezeigt, dass Fachwissen allein oft nicht das Wichtigste ist.
REISE NACH NIKOPOL. Im Mai 2008 bin ich gerade in der Wiener City unterwegs, als mein Telefon läutet. Es ist meine Assistentin: „Hallo Alois, da ist jemand aus der Ukraine, der dringend mit dir sprechen will.“ Ich nehme das Gespräch an, und es meldet sich in sehr schlechtem Englisch der Technikvorstand eines Rohrproduzenten in Nikopol. Weder der Ort noch das Unternehmen sagen mir etwas, aber genau das weckt meine Neugier. Es stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrieb mit 2.000 Mitarbeitern handelt, der seine Wettbewerbsfähigkeit dringend verbessern muss.
Zwei Wochen später sitze ich gemeinsam mit einem Mitarbeiter im Flugzeug nach Dnepropetrowsk – heute Dnipro –, um einen Quick Check durchzuführen. Schon das Aufsetzen des Flugzeugs lässt große infrastrukturelle Mängel vermuten, denn die Landebahn ist mehr als desolat. Ich werde vom Eigentümer des Unternehmens abgeholt, der mich direkt zum Werk bringt. Die Fahrt führt über Straßen, die von Schlaglöchern übersät ist. Der Unternehmer erzählt mir, dass ein großes Investitionsprogramm für 100 Millionen Dollar in Umsetzung begriffen ist. Die Produktivität des gesamten Unternehmens muss drastisch gesteigert werden. Wir wurden auf Basis eines sehr erfolgreichen Projekts für einen Mitbewerber in Österreich angefragt. Neben uns bieten weitere zwei internationale Beratungsunternehmen an.
Nikopol selbst macht den Eindruck einer postkommunistischen Stadt: hässliche Gebäude und Lieblosigkeit, wohin das Auge blickt. So richtig schockiert bin ich, als wir zur Fabrik kommen. Es handelt sich um das Gelände eines früheren sowjetischen Stahlkombinats, in dem in seiner besten Zeit mehr als 20.000 Leute arbeiteten. Unser Fahrzeug kann sich zwischen tiefen Schlaglöchern nur mehr im Schritttempo bewegen. Auf den Gebäuden prangt überall der Sowjetstern mit Reliefs von Lenin und Stalin. Irgendwie habe ich den Eindruck, als wäre der Zweite Weltkrieg, in dem mein Vater in dieser Stadt gekämpft hat, gerade erst zu Ende gegangen.
Ich schiebe diese Gedanken zur Seite, wir müssen Fakten für das Projektangebot sammeln. Mein Kollege und ich führen strukturierte Interviews, machen Beobachtungen im Werk und analysieren Zahlen. Die Verbesserungsmöglichkeiten sind unschwer zu erkennen. Viele Bereiche sind überbesetzt, Leistungskontrollen gibt es nirgends, und die Prozesse sind manuell und kompliziert.
Zwei Wochen später sitze ich gemeinsam mit einem Mitarbeiter im Flugzeug nach Dnepropetrowsk – heute Dnipro –, um einen Quick Check durchzuführen. Schon das Aufsetzen des Flugzeugs lässt große infrastrukturelle Mängel vermuten, denn die Landebahn ist mehr als desolat. Ich werde vom Eigentümer des Unternehmens abgeholt, der mich direkt zum Werk bringt. Die Fahrt führt über Straßen, die von Schlaglöchern übersät ist. Der Unternehmer erzählt mir, dass ein großes Investitionsprogramm für 100 Millionen Dollar in Umsetzung begriffen ist. Die Produktivität des gesamten Unternehmens muss drastisch gesteigert werden. Wir wurden auf Basis eines sehr erfolgreichen Projekts für einen Mitbewerber in Österreich angefragt. Neben uns bieten weitere zwei internationale Beratungsunternehmen an.
Nikopol selbst macht den Eindruck einer postkommunistischen Stadt: hässliche Gebäude und Lieblosigkeit, wohin das Auge blickt. So richtig schockiert bin ich, als wir zur Fabrik kommen. Es handelt sich um das Gelände eines früheren sowjetischen Stahlkombinats, in dem in seiner besten Zeit mehr als 20.000 Leute arbeiteten. Unser Fahrzeug kann sich zwischen tiefen Schlaglöchern nur mehr im Schritttempo bewegen. Auf den Gebäuden prangt überall der Sowjetstern mit Reliefs von Lenin und Stalin. Irgendwie habe ich den Eindruck, als wäre der Zweite Weltkrieg, in dem mein Vater in dieser Stadt gekämpft hat, gerade erst zu Ende gegangen.
Ich schiebe diese Gedanken zur Seite, wir müssen Fakten für das Projektangebot sammeln. Mein Kollege und ich führen strukturierte Interviews, machen Beobachtungen im Werk und analysieren Zahlen. Die Verbesserungsmöglichkeiten sind unschwer zu erkennen. Viele Bereiche sind überbesetzt, Leistungskontrollen gibt es nirgends, und die Prozesse sind manuell und kompliziert.
Wir führen gute Gespräche auf Augenhöhe, und ich spüre, dass hier echtes Interesse an Veränderungen vorhanden ist. Am Nachmittag des zweiten Tags ordnen wir die Fakten, erarbeiten die Schlussfolgerungen und stellen die Angebotspräsentation zusammen. Wir kommen auf ein Angebotsvolumen von über einer Million Euro und mögliche Verbesserungen von mehr als fünf Millionen pro Jahr.
DIE WIRKUNG VON KRENWODKA. Am Abend vor der Präsentation sind wir vom Eigentümer mit dem gesamten Management zu einem Abendessen am Ufer des Dnjepr eingeladen – mit Blick auf das mittlerweile „berühmte“ Kernkraftwerk Saporischschja. Ich bin gespannt, was hier auf mich zukommt. Es ist ein heißer Sommerabend, die Tische biegen sich unter russischen Köstlichkeiten.
Nach dem Essen verabschiedet sich der Eigentümer und CEO und der eigentliche Abend beginnt. Es kommt ein Getränk auf den Tisch, von dem ich vorher und auch nachher nie etwas gehört habe: Krenwodka, mit geriebenem Kren versetzter Wodka, der warm getrunken wird. Es schmeckt, ehrlich gesagt, widerlich, aber ich weiß: Da muss ich jetzt durch. Mein Kollege verabschiedet sich rasch, sodass nur mehr die Führungsmannschaft und ich am Tisch sitzen. Wir unterhalten uns geschäftlich auch über privat, während ein Glas nach dem anderen zu leeren ist. Jeweils auf „ex“.
Nachdem der anfängliche Widerwillen durch die Wirkung des Wodkas überwunden ist, geht es Glas für Glas weiter. Nach und nach verlassen die Gäste den Ort, bis am Schluss nur mehr der Technikvorstand und ich am Tisch sitzen. Mit schwerer Zunge und in gebrochenem Englisch fragt mich mein Gegenüber: „Alois, are you sure that you can help us here? We really need help!“ Gerade noch der Sprache mächtig, antworte ich: „Dmitri, it will be a honour for me to do that, but I can only help you, if you fully support me all the way!“ Darauf schlagen wir ein. Nach weiteren zwei Gläsern hat dann auch Dmitri genug, und wir umarmen uns als Zeichen gegenseitiger Wertschätzung.
Wir gewinnen den Auftrag, und wieder einmal bewahrheitet sich: Fachwissen und Professionalität allein genügen nicht. Das Wichtigste sind das Herz und das daraus entstehende Vertrauen.
Wir führen gute Gespräche auf Augenhöhe, und ich spüre, dass hier echtes Interesse an Veränderungen vorhanden ist. Am Nachmittag des zweiten Tags ordnen wir die Fakten, erarbeiten die Schlussfolgerungen und stellen die Angebotspräsentation zusammen. Wir kommen auf ein Angebotsvolumen von über einer Million Euro und mögliche Verbesserungen von mehr als fünf Millionen pro Jahr.
DIE WIRKUNG VON KRENWODKA. Am Abend vor der Präsentation sind wir vom Eigentümer mit dem gesamten Management zu einem Abendessen am Ufer des Dnjepr eingeladen – mit Blick auf das mittlerweile „berühmte“ Kernkraftwerk Saporischschja. Ich bin gespannt, was hier auf mich zukommt. Es ist ein heißer Sommerabend, die Tische biegen sich unter russischen Köstlichkeiten.
Nach dem Essen verabschiedet sich der Eigentümer und CEO und der eigentliche Abend beginnt. Es kommt ein Getränk auf den Tisch, von dem ich vorher und auch nachher nie etwas gehört habe: Krenwodka, mit geriebenem Kren versetzter Wodka, der warm getrunken wird. Es schmeckt, ehrlich gesagt, widerlich, aber ich weiß: Da muss ich jetzt durch. Mein Kollege verabschiedet sich rasch, sodass nur mehr die Führungsmannschaft und ich am Tisch sitzen. Wir unterhalten uns geschäftlich auch über privat, während ein Glas nach dem anderen zu leeren ist. Jeweils auf „ex“.
Nachdem der anfängliche Widerwillen durch die Wirkung des Wodkas überwunden ist, geht es Glas für Glas weiter. Nach und nach verlassen die Gäste den Ort, bis am Schluss nur mehr der Technikvorstand und ich am Tisch sitzen. Mit schwerer Zunge und in gebrochenem Englisch fragt mich mein Gegenüber: „Alois, are you sure that you can help us here? We really need help!“ Gerade noch der Sprache mächtig, antworte ich: „Dmitri, it will be a honour for me to do that, but I can only help you, if you fully support me all the way!“ Darauf schlagen wir ein. Nach weiteren zwei Gläsern hat dann auch Dmitri genug, und wir umarmen uns als Zeichen gegenseitiger Wertschätzung.
Wir gewinnen den Auftrag, und wieder einmal bewahrheitet sich: Fachwissen und Professionalität allein genügen nicht. Das Wichtigste sind das Herz und das daraus entstehende Vertrauen.